| / Ein tolles Lied,... jenna jones / bilder nur gedacht veicolare / Flüchtigkeit veicolare / Endlich Licht! veicolare | Menu |

|
|
|
... neuere Stories
13
02 14 Semana Boléro - 4
Boléro People
Auch wenn dem Dirigenten in der klassischen Musik stets eine Sonderrolle zukommt - allein ist er nicht. Hörbar wird die Musik erst durch die vor ihm sitzende Gruppe von Künstlern, das Orchester. 1973 begleiteten William Fertik und Allan Miller die Los Angeles Philharmoniker und ihren Dirigenten Zubin Mehta während der Vorbereitung zu Ravels Boléro mit der Kamera. Der so enstandenen Kurzfilm "The Bolero", der übrigens einen Acadamy Award, besser bekannt als "Oscar", erhielt, erlaubt einen anderen Blick auf das Stück. In kleinen Interviews erzählen die Musiker von den vielen spielerischen Besonder- und Kniffeligkeiten des Boléro, ihren Bezug zur Musik im Allgemeinen aber auch von Lampenfieber ... Und um noch bei den "Boléro People" zu bleiben - in der Schulzeit erzählte man uns, der Trommler im Boléro habe den anspruchsvollsten Job aller Musiker. Klar, er fängt es an, er führt es fort, er muss den Rhythmus bis zum Schluß in gleicher Weise halten, und das bekanntlich bis zu 18:11 Minuten lang. Das sei alles andere als einfach, und deshalb würden sich teilweise mehrere Trommler diese Aufgabe teilen. Nun, letzteres war wohl eine Übertreibung, zumindest habe ich dergleichen noch nie gesehen. Im Gegenteil, der Filmemacher Patrice Leconte widmet eben jenem einen Trommler, dem "Rückgrat des Boléro", besondere Aufmerksamkeit, besser gesagt, er gibt ihm gleich die Hauptrolle. So heißt der 1992 entstandene Film auch "Le batteur du boléro". Wobei - so hundertprozentig ernst gemeint ist dieser Film dann wohl auch wieder nicht. ;-)
12
02 14 Semana Boléro - 3
Wie lang dauert der Boléro?
Daran scheiden sich die Geister. Ravel selbst setzte die Länge auf 17 Minuten fest, in seinem Werksverzeichnis ist dagegen von 16 Minuten die Rede. Viele Einspielungen dauern dagegen nur 14 Minuten. Letztlich ist Musik, trotz Notation des Tempos, ja immer auch eine Sache der Interpretation, also auch die Spielgeschwindigkeit. Ravel selbst hatte sich den Boléro als einen "sehr langsamen" Tanz vorgestellt. Dementsprechend ist überliefert, wie er einmal mit dem Dirigenten Arturo Toscanini regelrecht aneinander geriet, weil er der Ansicht war, dieser habe den Boléro zu schnell gespielt. Dann solle er ihn besser gar nicht spielen! Toscanini hielt dagegen, Ravel habe keine Ahnung von seiner eigenen Musik... Mehr Gefallen hätte Ravel sicher an der Version des Rumänen Sergiu Celibidache gefunden. Dieser brachte den Boléro mit den Münchener Philharmonikern auf die Rekordlänge von 18:11 Minuten. Hier eine Aufnahme von 1994, da war Celibidache über 80 - eine Tatsache, mit der das Tempo seines Boléros aber sicher in keinem Zusammenhang steht ;-) Und hier der selbe Mann 29 Jahre früher, 1965, ebenfalls mit dem Boléro, jedoch nicht im Konzert, sondern während der Proben mit dem Schwedischen Radio-Orchester. Ein seltener Einblick:
11
02 14 Semana Boléro - 2
Flashmob!
Der Boléro als Flashmob - die ideale Kombination! Zu Beginn steht ein einsamer Trommler irgendwo in einer Fußgängerzone, nach und nach tauchen wie aus dem Nichts weitere Musiker auf, bis schließlich zum furiosen Finale ein ganzes Orchester auf dem Platz steht. Und die Passanten können nur staunen und sich freuen. Hier beispielsweise über die Banda Simfònica der Stadt Algemesí an der spanischen Mittelmeerküste. Wie bei den meisten Flashmob-Performances wird auch hier eine verkürzte Variante mit reduziertem Instrumentenaufgebot gegeben, einfach um die Sache fußläufig händelbar zu machen, ansonsten müsste man noch mehr Musiker und außerdem eine Harfe und eine Celeste mit dabei haben. In dieser Form der Straßenmusik wird der Boléro vollends zur Weltmusik. Flashmobs liegen im Trend und so kann Ravels spanischer Tanz heute überall plötzlich erklingen, zum Beispiel: in Toluca, Mexiko in Sao Paulo, Brasilien in Kristiansand, Norwegen in Chemnitz, Deutschland in Brisbane, Australien und so weiter, und so weiter ...
10
02 14 Semana Boléro - 1
Ein spanischer Tanz ...
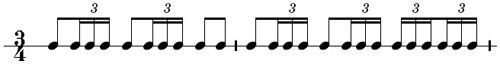 "Boléro" von Maurice Ravel - ein Stück, das sicherlich seinen festen Platz hat zwischen den weltweit bekanntesten und meistgespielten Stücken klassischer Musik. Dabei macht es bereits beim Versuch einer solchen "Etikettierung" Probleme. Uraufgeführt wurde es 1928, vor gerade mal 86 Jahren. Ein Beispiel moderner Musik des 20. Jahrhunderts? Nun, Gershwins "Rhapsody in Blue" steht es ganz sicher näher als allen Orchesterwerken vergangener Jahrhunderte. Gleichzeitig schöpft es jedoch auch stark aus musikalischer Folklore. Ravels Ausgangspunkt war die Idee eines spanischen Tanzes, und als solcher vereint der Boléro in sich verschiedenste Strömungen: die der westeuropäischen Klassik, doch auch die der spanischen Gitanos, den Flamenco, dann sicher auch Einflüsse maurischer Musik, die ja auf der iberischen Halbinsel in allem irgendwie drinstecken, und schlußendlich, in manchen Klängen, vor allem denen der Posaune, den Jazz. Universelle Musik der Neuzeit. Noch 1928, als das Publikum doch eigentlich schon vieles gewöhnt war, provozierte der Boléro. Ein Stück mit nur zwei Themen, die einfach immer und immer wiederholt werden, 18 mal insgesamt. Überliefert ist der Ausruf einer Besucherin der Uraufführung: "Hilfe, ein Verrückter". Ravel pflichtete ihr bei. Vielleicht waren es auch die von vielen als lasziv empfundenen Tanzbewegungen der Tänzerin Ida Rubinstein, die diesen Ausruf provozierten, denn geschrieben hatte Ravel den Boléro für sie und ursprünglich als eine Ballettmusik, als einen "... einsätzigen Tanz, sehr langsam und ständig gleich bleibend ..." Der Boléro ist Ravels bekanntestes Werk, was er selbst ironisch kommentierte: "Ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der Boléro; leider enthält er keine Musik." So gesehen ist der Boléro tatsächlich wenig mehr als ein langgezogenes Crescendo, ähnlich einer Einführung zu einem großen musikalischen Werk, das dann jedoch nie beginnt. Und gerade deshalb behauptet sich das, was da zu hören ist, umso mehr, drängt sich in die Hörgewohnheiten und wird zum Fanal einer neuen Art von Musik. Zu einem Ohrwurm übrigens auch! Das schräge, hin- und her mäandernde Thema lässt den Hörer nicht mehr los. Ich hörte es wohl zuerst im Schulunterricht. Ja, natürlich, an welchem anderen Stück ließen sich die einzelnen Instrumente des Orchesters so schön durchbuchstabieren. Bis heute wird mir der Boléro nicht fad, so oft ich ihn auch höre. Und deshalb soll die heute beginnende Woche in diesem Blog einmal ganz im Zeichen des Boléro stehen. Sieben mal Boléro - ich glaube, da ist einiges zu entdecken. Zum Start dieser "Semana Boléro" zuerst einmal das Stück an sich, und zwar in einer Aufnahme der Wiener Philharmoniker unter Leitung von Riccardo Muti, eine kraftvolle Version, die wie ich finde, den rhytmischen Charakter des Boléro sehr betont. Bitte schön: Und nun nocheinmal zurück zum Ursprung des Boléros, zum Ballett. Von diesem hat sich das Stück seit damals weitestgehend gelöst, wird heute in erster Linie als instrumentales Stück wahrgenommen und seine eigentlich tänzerische Natur ist vielen Menschen nicht mehr bewußt. Die folgende Performance macht sie wieder augenfällig. Sylvie Guillem tanzt den Boléro, wie einstmals Ida Rubinstein, allein in einem Kreis von Tänzern und zeigt dabei eine höchst eigene Bewegungsdynamik. Habe sie in diesem Zusammenhang entdeckt. Empfehle den Vollbildmodus!
09
02 14 
... ältere Stories
|
